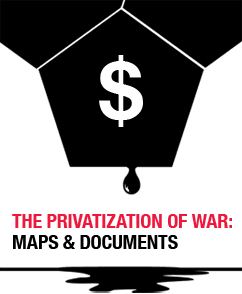Zu den gesellschaftlichen Umwälzungen in Venezuela unter Hugo Chávez
Den Prozess des Ausschlusses umkehren
Mit der Übernahme der venezolanischen Präsidentschaft am 2. Februar 1999 beendete der Ex-Armeeoberst Hugo Chávez eine de facto vierzig Jahre währende Zweiparteienherrschaft der sozialdemokratischen Acción Democrática und der christlich-sozialen Copei.1 Diese vertraten einen stetig schrumpfenden Bevölkerungsanteil des viertgrößten Erdölexporteurs der Welt: vorwiegend die an das Rentenmodell des staatlichen Ölsektors gekoppelte Oberschicht und die seit den 1980er Jahren verarmende Mittelschicht. Chávez, der 1992 einen Putschversuch gegen Präsident Carlos Andrés Perez unternommen hatte, führte im Wahlkampf einen anti-neoliberalen Diskurs, vor allem gegen die eingeleitete Privatisierung des staatlichen Erdölkonzerns Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), und versprach den Weg für eine neue Verfassung zu ebnen.
Chávez gewann 56 Prozent der Stimmen und setzte zwei parallele Prozesse in Gang: Reinstitutionalisierung und soziale Umwälzung von unten. Reinstitutionalisierung meint den Versuch, den Institutionen des Staates, Ämtern und Funktionen, wieder Legitimität zu verleihen und sie funktionsfähig zu machen. Beide Prozesse sind miteinander verwoben, komplementär, teilweise aber auch konträr. Insgesamt wird der Transformationsprozess in Anlehnung an den antikolonialen Freiheitskämpfer Simón Bolivar als »Bolivarianischer Prozess« bezeichnet. Bolivar kämpfte Anfang des 19. Jahrhunderts für einen souveränen und republikanischen Staatenbund in Südamerika.
Wenige Wochen nach der Amtsübernahme Chávez wurde eine verfassungsgebende Versammlung gewählt und eine neue Verfassung erarbeitet, die im Dezember 1999 via Referendum mit 72 Prozent der Stimmen angenommen wurde. Chávez wurde 2000 in Wahlen gemäß der neuen Verfassung mit 59,76 Prozent erneut Präsident. Die Regierung besteht heute aus drei linken, einer multiethnischen und einer indigenen Partei und wird von einer Vielzahl von Basisorganisationen und kleineren linken Parteien gestützt.
Mit Chávez gewann der Kandidat, der am weitesten von den traditionellen Kräften entfernt war. Seine Wahl war das Ergebnis einer zunehmenden sozialen Polarisierung bei gleichzeitigem Zerfall des traditionellen Repräsentationsgefüges. So sind weder der Niedergang der traditionellen Parteien und Gewerkschaften Venezuelas noch die soziale Polarisierung von Chávez verursacht, wie häufig behauptet wird, sondern im wesentlichen sozioökonomischen Ursprungs. Venezuela verfügte in den 1980er und 1990er Jahren über die niedrigsten Wachstumsraten des Kontinents (im Minusbereich) und eine hohe Inflationsrate, die 1996 hundert Prozent erreichte. Ende der neunziger Jahre lebten etwa achtzig Prozent der Bevölkerung in Armut und waren von der politischen und gesellschaftlichen Partizipation, Bildung und Gesundheitsversorgung und selbst von der materiellen Grundversorgung weit gehend ausgeschlossen.
Bis zum »Caracazo« genannten Volksaufstand 1989 galt Venezuela, gemessen an liberal-demokratischen Indikatoren wie regelmäßigen Wahlen, der Respektierung gewisser Bürgerrechte usw. als Vorzeigedemokratie Lateinamerikas. Auslöser des Aufstandes war eine drastische Preiserhöhung im Personentransport in Caracas am 27. Februar 1989 im Rahmen eines von Präsident Carlos Andrés Pérez angekündigten strengen neoliberalen Programms nach IWF-Vorgaben. Von der Hauptstadt griffen die Aufstände innerhalb eines Tages auf nahezu alle großen und mittleren Städte des Landes über. Es kam zu massiven Plünderungen. Nach einer Woche wurde der Aufstand von der Armee und der Nationalgarde niedergeschlagen. Dabei wurden ein- bis dreitausend Menschen getötet. So stellt das Jahr 1989 einen Wendepunkt in der Geschichte Venezuelas dar.
Das delegitimierte politische System reagierte seit den 1980er Jahren mit harter Repression und sanften Reformen. Zur Herrschaftskonsolidierung integrierte es Eliten außerhalb der politischen Sphäre. Doch die erklärte Öffnung zur »Zivilgesellschaft« betraf nur eine reduzierte Gruppe europäischer ImmigrantInnen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen. Dies führte zu einer weiteren Marginalisierung der Mehrheit und einem Anstieg des staatlichen Legitimitätsverlustes. Daher, so der venezolanische Philosoph und Basisaktivist Roland Denis, forderten die unteren Klassen nicht eine Öffnung für die Zivilgesellschaft, sondern einen direkten Protagonismus der Bevölkerung und »konstituierenden Macht«.2
In den neunziger Jahren wurden die Proteste immer breiter. Eine Vielzahl sozialer und politischer Akteure kämpfte, angesichts des sie marginalisierenden neoliberalen Paradigmas, für einen zentralen Platz der sozialen Rechte der Bevölkerung in der politischen Agenda. Die autonomen sozialen Kämpfe organisierten sich zunehmend und begannen, in einem gemeinsamen neuen politischen Projekt zusammenzufließen. Sie verwandelten sich so vom bloßen Widerstand zu einer schaffenden, konstituierenden Macht.
Roland Denis hebt diesbezüglich die grundlegende Rolle der Struktur der Stadtteileversammlung hervor, »als Zentrum der Einweihung der gesellschaftlichen Macht im Land und als aktiver Artikulationsort der Basiskämpfe. Ein Raum der Debatte und Aktionseinheit, der dem ideologischen Diskurs, aufbauend auf der Autonomie der Volksmacht und der Notwendigkeit der souveränen Räume, in denen die Volksmacht als grundlegende Kraft der Legitimierung der neuen Demokratie ihren Ausdruck findet, letztlich einen hegemonialen Ort verlieh.«3
Wenn Chávez heute vorgeworfen wird, unter seiner Präsidentschaft finde eine Zurückdrängung der Zivilgesellschaft statt, so gilt es genau zu schauen, wer diesen Vorwurf erhebt. Die AkteurInnen, die heute als »Zivilgesellschaft« auftreten, sind gegenüber dem Westen die VertreterInnen des alten Systems. Weder repräsentieren sie einen gesellschaftlichen Konsens noch sind sie in der Lage, ihn zu erzeugen.
Mit bloßem Augenschein erkennbar ist die soziale Zusammensetzung der Bolivarianischen Bewegung und der Opposition. Die Anhänger Chávez’ kommen vorwiegend aus den unteren Schichten der Bevölkerung und sind häufig dunkelhäutig, schwarz oder indigener Herkunft, während sich die Oppositionsdemonstrationen aus der weit gehend hellhäutigen Mittel- und Oberschicht rekrutieren.
Eine entscheidende Rolle für die breite Unterstützung spielen das Gefühl der Armen und Marginalisierten, als Personen anerkannt zu werden, das verinnerlichte neue Gefühl, im Recht zu sein, in den Institutionen mit Respekt behandelt zu werden, sowie die Möglichkeit, an kollektiven Kämpfen teilzunehmen, ohne Angst vor Repression haben zu müssen. Das in Unterdrückungsverhältnissen häufig vorhandene Gefühl der eigenen Minderwertigkeit und Unfähigkeit wurde umgekehrt. »Die Bolivarianische Revolution hat es vielen Leuten erlaubt zu sehen, dass es möglich ist, den Prozess, mittels dessen das Opfer des Ausschlusses selbst zur Reproduktion des Stigmas tendiert, umzukehren«, so der kolumbianische Historiker Medófilo Medina.4
Von der Bolivarianischen Revolution zu einer neuen Verfassung
Eine konstituierende Rolle kommt hier dem Prozess der Erarbeitung und Verabschiedung der neuen Verfassung zu. NGOs und soziale Organisationen nahmen über Workshops, Kommissionen und runde Tische direkt an der verfassungsgebenden Versammlung teil und brachten ihre Vorschläge ein. Daher stellt die Verfassung auch den zentralen Bezugspunkt sozialer und politischer Forderungen der Unterschichten und von Teilen der Mittelschicht dar.
Die Bolivarianische Verfassung (RBV 1999) führt plebiszitäre Elemente und Partizipationsmechanismen, komplexe Menschenrechte sowie spezielle Frauen-, Indígena- und Umweltrechte ein. Sie legt soziale Bürgerrechte (»social citizenship«) und die soziale Gleichheit als Ziel der Gesellschaftsordnung und den Staat als Garant dafür fest. Die Rechte und Partizipationsmechanismen sollen durch Regierungsprogramme und Gesetze gesellschaftlich umgesetzt werden. Über Sozialmaßnahmen, kostenlose Bildungsmöglichkeiten, Kleinkreditwesen sowie Landumverteilung soll die egalitäre soziale und ökonomische Partizipation der marginalisierten Schichten ausgeweitet werden. Viele Punkte widersprechen dabei weltweit hegemonialen und neoliberalen Parametern, darunter zum Beispiel der Aufbau eines staatlich-öffentlichen, kostenfreien Gesundheitssystems, das nicht privatisiert werden darf, der Aufbau eines staatlich-solidarischen Sozialversicherungssystems und die Anerkennung der Hausarbeit als »Mehrwert und Reichtum produzierend«, woraus die Möglichkeit einer Sozialversicherung erfolgt und eine kostenlose öffentliche Schul- und Universitätsbildung. Das Recht der indigenen Bevölkerung auf ehemals genutztes Land und Gewässer in kollektiver und unveräußerlicher Form, die Anerkennung ihrer sozialen, politischen und ökonomischen Organisationsformen sowie das Verbot, Genome von Lebewesen zu patentieren sind ebensowenig neoliberale Parameter wie der Beschluss, dass der Kernbereich des Erdölunternehmen PDVSA im Staatsbesitz zu verbleiben hat und die Bestimmung, dass Wasser ein Gut öffentlicher Handhabe ist und dass Großgrundbesitz dem gesellschaftlichem Interesse widerspricht.
In der Verfassung werden erstmals auch kulturelle Rechte festgelegt und die Populärkultur aufgewertet. Kultur wird in unterschiedlichsten Bereichen und auf unterschiedlichste Weisen stark gefördert: Der Eintritt in Museen ist kostenlos, es gibt zahlreiche neue Stipendien- und Förderprogramme für alle Künste, eine erhöhte nationale Filmproduktion und viele Förderungen für unabhängige KünstlerInnen. Mit ViveTV wurde im September 2003 ein staatlich finanzierter, aber eigenständig arbeitender Kulturkanal gegründet. Auch finden häufig große Kulturkongresse (Literatur, Poesie und anderes) statt.
Allerdings fehlt bisher ein Gesetz, welches die Kulturpolitik regelt – wie übrigens in vielen anderen Bereichen auch, da Gesetzgebungsverfahren langwierig sind. Dadurch sind die Kompetenzen im Kulturbereich nicht genau geregelt und die Verteilungs- sowie Entscheidungsmechanismen teilweise unübersichtlich und stark personalisiert. Ein im August in erster Lesung verabschiedetes Kulturgesetz – um in Kraft zu treten, muss es nach weiteren Konsultationen einen zweites Mal verabschiedet werden – stößt auf die Ablehnung einiger Kulturschaffender. Das Gesetz wurde aus zwei konträr zueinander stehenden Entwürfen – der erste stark partizipativ, der zweite eher traditionell ausgerichtet – zusammengeflickt. Der Vorsitzende der »parlamentarischen Kommission für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit« Luis Acuña, erkannte Ende August an, das Gesetz »stelle nicht alle Kultursektoren zufrieden«, jedoch sei es noch nicht endgültig verabschiedet. Deswegen seien alle Sektoren aufgefordert, ihre Ansicht der Kommission mitzuteilen, damit »die notwendigen Korrekturen vorgenommen werden können«.
Viele Kulturinitiativen fordern ähnlich der verfassungsgebenden Versammlung eine »konstituierende Kulturversammlung«, auf der die Rahmenrichtlinien der Kulturpolitik von der Basis festgelegt werden. In einzelnen Bundesstaaten werden bereits solche Versammlungen vorbereitet, auch der mitunter umstrittene Kulturminister hat seine Unterstützung zugesagt.
Grundlage der Verfassung ist – in Abgrenzung zur repräsentativen Demokratie – die »partizipative und protagonistische Demokratie«, das heißt, der Staat wird als partizipativer Raum verstanden, in dem die Bevölkerung mittels diverser Instrumente das öffentliche Leben mitgestaltet und die Institutionen kontrolliert. Dazu gehört die Erweiterung der drei Gewalten um (1) die »Bürgergewalt«, ausgeübt vom »Republikanischen Moralrat«, der aus Generalstaatsanwalt, Oberstem Rechnungsprüfer und Ombudsmann besteht und für »öffentliche Ethik und Verwaltungsmoral« sowie Erziehungs- und Bildungsfragen zuständig ist; und (2) die autonome »Wählergewalt«, verkörpert durch den »Nationalen Wahlrat« CNE. Zudem können gewählte Amtsträger mittels Referendum nach Hälfte des Mandats abgewählt werden. Auf lokaler Ebene wurde ein Mitspracherecht der Bevölkerung bei der Aufstellung und Verteilung des Haushaltes eingeführt.
Präsident Chávez kommt in dem Prozess eine besondere Rolle zu. Oft, vor allem in Europa und den USA, wird er als »Populist« oder »Neopopulist« charakterisiert. Tatsächlich bestehen zwischen Chávez’ Politik und Modellen des (Neo-)Populismus klare Unterschiede. Chávez’ Rolle ist komplexer. Es gelingt ihm, mit der verstreuten Masse zu kommunizieren, die in Folge der vom Neoliberalismus geförderten Zersplitterung und Individualisierung keine organisatorische Einbindung hat. Zugleich wirkt er als integrative Figur für alle am Prozess beteiligten Organisationen und Bewegungen und ist der Garant für die ständige Inklusion der sozialen Bewegungen in den Prozess, da er den Ausgleich zu den oft traditionellen Praxen der an der Regierung beteiligten Parteien bildet. Entgegen populistischer Praxen unterstützt die Regierung die Selbstorganisierung. So fußen die Regierungsprogramme meist auf Eigeninitiative organisierter oder zu organisierender Gruppen und Stadtteile, die dann technische und finanzielle Hilfeleistungen erhalten.
Während in Europa und den USA immer wieder Zweifel am demokratischen Charakter des venezolanischen Prozesses geäußert werden, resümiert der venezolanische Soziologe Edgardo Lander: »Die Transformationen in der politischen Kultur und die Inklusionsprozesse, die Integration als Subjekte politischen und organisatorischen Handelns, der armen Mehrheiten des Landes, die marginalisiert waren – das ist die wichtigste Eroberung in Richtung einer demokratischeren Gesellschaft«.5
Für eine tief gehende Betrachtung des Prozesses in Venezuela braucht es einen Demokratiebegriff, der über die liberal-demokratische Institutionenanalyse hinausgeht. So wie Laclau und Mouffe das Ziel der Linken in der Vertiefung der vor zweihundert Jahren begonnenen demokratischen Revolution sehen,6 erklärt der Bolivarianische Prozess genau dies zur Aufgabe. Die Ideale der »Freiheit«, »Gleichheit«, »Gerechtigkeit«, »Demokratie« – und aus der Situation und Geschichte Venezuelas heraus »Unabhängigkeit« – werden als bisher unerfüllt bezeichnet, aktualisiert und neu definiert. Radikale Demokratie meint im Sinne von Laclau und Mouffe eine Radikalisierung der demokratischen Revolution, indem die Ideale auf immer mehr gesellschaftliche Bereiche, in denen Herrschaftsbeziehungen existieren, ausgedehnt werden. In diesen nehmen die von den dort herrschenden Unterdrückungs¬verhältnissen Betroffenen eine radikalere – im Sinne einer tieferen, an die Wurzeln reichenden – Interpretation der Ideale vor.
Zugleich lässt sich die Bedeutung der pluralen sozialen Bewegungen für den Transformationsprozess in Venezuela ebenfalls gut mit dem hegemoniekritischen Ansatz der Radikalen Demokratie analysieren. Dieser sieht Demokratie als Prozess der Ausweitung politischer Räume und ermöglicht den Blick auf NGOs und soziale Bewegungen in der Konstruktion und Ausweitung der Partizipation. So haben etwa auch die Sozialwissenschaftlerinnen María Pilar Garcia-Guadilla und Monica Hurtado den verfassungsgebenden Prozess auf der Grundlage der Radikalen Demokratie analysiert. Die Verfassung habe, so García-Guadilla, »neue Identitäten und Konzepte von ›citizenship‹ und Demokratie eingeführt, die auf der Partizipation beruhen. Andererseits hat der verfassungsgebende Prozess gezeigt, wie die Heterogenität einer Zivilgesellschaft und die Diversität der Interessen die Kooperation und die Solidarität zwischen den Organisationen nicht verhindert hat«7.
»Eine der einzigartigen Charakteristiken der Bolivarianischen Revolution liegt darin, dass es keine eigentliche Avantgarde gibt, die die revolutionäre politische Handlung anführt, sondern eine breite soziale Front, die aus verschiedenen Bewegungen besteht. Die einen organisiert als politische Parteien und andere als ein System von Basiskollektiven, die um die Bolivarianischen Zirkel und die diversen sozialen Missionen und Pläne gruppiert sind und mindestens sechzig Prozent der Venezolaner umfassen. Dies ermöglicht, dass der Reformprozess, der beginnt, die qualitativen Veränderungen zu stimulieren, in einem demokratischen Kontext vollzogen werden kann, dessen Dynamik durch Partizipation der verschiedenen Kollektive als Protagonisten bestimmt wird«, so resümieren die spanischen Sozialwissenschaftler Mario Sanoja Obediente und Iraida Vargas-Arenas.8
In Venezuela existiert keine vorgegebene oder bevorzugte Organisationsform, weder in Struktur noch in Inhalt oder Orientierung. Tatsächlich sind am Prozess UmweltaktivistInnen, Frauen, MigrantInnen, Sex-Arbeiterinnen, Behinderte, Indígenas, Schwarze, Bauern, ArbeiterInnen, Schwule und Lesben mit eigenen Organisationen beteiligt, auch wenn weiterhin Ungleichheiten in der öffentlichen und gesellschaftlichen Anerkennung der verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse bestehen. Ziel ist aber, um mit Chantal Mouffe zu sprechen, »ein ›wir‹ als radikaldemokratische ›citizens‹ aufzubauen, eine kollektive politische Identität, die mittels des Prinzips der demokratischen Äquivalenz artikuliert wird. Es muss aber unterstrichen werden, dass diese Beziehung der Äquivalenz die Unterschiede nicht eliminiert«9.
1 Der »unabhängige« Rafael Caldera (1994-1999) gehörte bereits formal nicht den Traditionsparteien an. Er war jedoch noch bis kurz vor den Wahlen unumstrittene Copei-Führungsfigur.
2 Vgl. Roland Denis, Los fabricantes de la rebelión (Movimiento Popular; Chavismo y Sociedad en los años noventa). Caracas 2001, S. 66 f.
3 Ebd., S. 22.
4 Medófilo Medina, Venezuela al rojo entre noviembre de 2001 y mayo de 2002; in: Medófilo Medina/Margarita López Maya, Venezuela – confrontación social y polarización política, Bogotá 2003, S. 48 f.
5 Vgl. Edgardo Lander, Venezuela – La búsqueda de un proyecto contrahegemónico, in: Ana Esther Ceceña (Hg.), Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI, Buenos Aires 2004, S.197-223.
6 Vgl. Ernesto Laclau/Chantal Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus. Wien 1991.
7 María Pilar García-Guadilla/Monica Hurtado, Participation and Constitution Making in Colombia and Venezuela. Paper for the Latin American Studies Association (LASA). Miami 2000, S. 241 f.
8 Mario Sanoja Obediente/Iraida Vargas-Arenas, La vía del cambio social. Un amplio frente social asume el rol de vanguardia, in: Question, Nr. 20, 2. Jg., Februar 2004.
9 Chantal Mouffe, Feminismo, ciudania, y politica democratica radical, in: Debate Deminista. Ciudadanía y Feminismo, México D.F. 2001, S. 47 (spanische Übersetzung von »Feminism, citizenship and radical democratic politics«, in: Judith Butler/Joan Scott (Hg.), Feminists Theorize the Political. New York 1992, S. 369-384).
http://www.springerin.at/