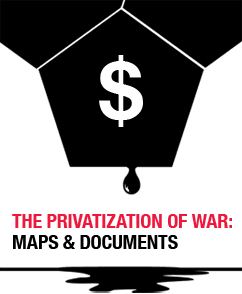Wieviel Kapitalismus kann das sozialistische Kuba Fidel Castros (v)ertragen?
„Die Geschichte wird mich freisprechen“
Für manche ist er ein Held, ein Vorbild und ein großer Politiker, für andere ein alter Mann und Sturkopf. Viele Lateinamerikaner sehen in ihm das Symbol der Souveränität gegenüber den USA, andere aber auch den Inbegriff des Diktators, der sich an überholte Konzepte klammert. Fidel Castro, der „maximo lider“, gehört sicher zu den umstrittensten Persönlichkeiten des amerikanischen Kontinents. Geliebt und verhasst gleichermaßen regiert er Kuba seit der Revolution von 1959, die die grausame, US-gestützte Diktatur von Batista ablöste.
Fidel Castro wurde 1926, manche Quellen satteln auch noch ein Jahr drauf, auf der Zuckerplantage seines Vaters geboren. Der junge Fidel besuchte eine Jesuiten-Schule, bevor er ab 1945 in Havanna Rechtswissenschaften studierte und fünf Jahre später zum Dr. jur. promovierte.
Bereits früh engagierte er sich politisch. 1947 beteiligte er sich in der Dominikanischen Republik an einem letzten Endes gescheiterten Aufstand. Auch als Anwalt vertrat er vornehmlich arme Kubaner und Kubanerinnen. Nachdem der Diktator Batista 1952 die Macht übernahm, organisierte Castro ein Jahr später am 26. Juli – so auch der Name seiner späteren Organisation – einen Angriff auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba. Doch der Aufstand, den er damit in der Provinz Oriente auszulösen erhoffte, blieb aus. Brutal wurde der Aufstand zurückgeschlagen und die Beteiligten zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Fidel Castro bekam 15 Jahre. Nach der Urteilsverkündung sprach er damals die berühmten Worte: “Die Geschichte wird mich freisprechen“.
Von der langjährigen Haftstrafe mußte Castro jedoch nur zwei Jahre absitzen. Amnestiert emigrierte er erst in die USA und später nach Mexiko. Von dort aus organisierte er den Kampf gegen die Batista-Diktatur, die aus Kuba ein Freudenhaus und Spielparadies der USA machte. Anfang Dezember 1956 landete er mit 82 Genossen an der Ostküste Kubas. Nur zwölf Personen, darunter auch Fidel Castro, überlebten die kriegerischen Auseinandersetzungen direkt nach der Landung und schlugen sich in die Berge der Sierra Maestra. Dort begannen sie die Guerilla-Bewegung des „26. Juli“ aufzubauen. Am 31.12.1958 fiel Santiago de Cuba in die Hände der Revolutionäre; noch in der selben Nacht verließ Diktator Batista fluchtartig das Land. Die Revolution war siegreich, und Castro galt als ihr „Vater“.
Von den USA geächtet, entwickelte sich das Verhältnis zwischen der jungen Revolution und Uncle Sam immer mehr zu einer, wie Castro einmal selbst sagte, „Kanonenboot-Diplomatie“. Kuba wandte sich dem Ostblock zu, der offen seine Bereitschaft für Hilfe und Kooperation signalisierte. In Kuba selbst nahm die Revolution immer mehr sozialistische Züge an. Die Industrie wurde nationalisiert, privater Großgrundbesitz verstaatlicht und in Kooperativen verwandelt, ausländisches Eigentum, wie etwa die Ölraffinerien der US-Multis, nationalisiert.
Nach dem von Kuba zurückgeschlagenen Invasionsversuch der USA in der Schweinebucht im April 1961 erklärte Castro Kuba zum sozialistischen Staat, schaffte Wahlen ab. Ein im Juli 1962 ausgehandeltes Militärabkommen Kubas mit der UdSSR führte im Oktober d. J. zu der „Kuba-Krise“. Die USA mochten nicht, wie die Sowjetunion in Europa, feindliche Offensivraketen vor der Haustür haben, verhängten eine Seeblockade gegen Kuba und erreichten den Abzug der sowjetischen Raketen.
Im Februar 1976 wurde per Volksabstimmung eine neue Verfassung verabschiedet, die Kuba als sozialistischen Staat definiert und außerdem eine Führungsrolle der KP festlegt. Seitdem gibt es auch wieder Wahlen. Das Parlament bestätigte immer wieder die Position Fidels als Vorsitzender des Staatsrates. Bei seiner letzten Wahl tat er jedoch kund, es sei wohl seine letzte Amtsperiode.
Castro und Kuba zeigten sich bereits früh mit vielen Befreiungsbewegungen und blockfreien Staaten solidarisch. Die Entsendung kubanischer Lehrer, Techniker und Ärzte in viele Länder der sogenannten Dritten Welt und die Bereitstellung von Stipendien dür Studenten aus jenen Ländern verschaffen Kuba viel Ansehen, die Entsendung von Soldaten zur Unterstützung gegen Militärinvasionen, etwa nach Angola, jedoch auch viel Kritik.
Umstritten war auch der „Fall Ochoa“, die Verurteilung und Erschießung einer Gruppe hochrangiger Militäroffiziere wegen Drogenhandels. Offiziell hieß es, die Offiziere hätten durch ihre Verwicklung in den internationalen Drogenhandel Kuba der Gefahr einer US-amerikanischen Invasion ausgesetzt. Zudem wurde ihnen noch Korruption vorgeworfen. Kritiker äußerten jedoch die Vermutung, daß Castro sich eines seiner schärfsten Konkurrenten entledigen wollte. Seit dem Kongreß der kubanischen KP vom Oktober 1991 werden die Kandidaten zur Nationalversammlung ohnehin direkt gewählt, und es fanden umfangreiche Umbesetzungen in der Führungsspitze von Staat und Partei statt.
Kubas Interesse galt immer der Suche nach Wegen aus der Unterentwicklung. Die Insel selbst setzte dabei auf das zentralistische sowjetische Entwicklungsmodell und scheiterte. So ist Kuba durch seine starke Spezialisierung zwar imstande, hochwertige Medikamente herzustellen, einfach Zahnbürsten müssen jedoch gegen teure Devisen importiert werden. Andererseits legte Kuba aber auch immer großen Wert auf Gesundheitsversorgung und Bildung. Im internationalen Rahmen forderte Castro seit 1979 die Staaten der „Dritten Welt“ immer wieder dazu auf, die Schulden an die Banken und Industrieländer nicht zurückzuzahlen.
Als Gorbatschow 1988 in der UdSSR die Perestrojka einleitete, wehrte sich Castro vehement gegen eine Übernahme der Reformen durch Kuba, erkannte aber gleichzeitig die Notwendigkeit von Kurskorrekturen. Die Perestrojka führe letztendlich nur ins Elend, so Castro. Kuba stand nach dem Wegfall seiner wichtigsten Handelspartner vor dem Zusammenbruch. Die einfachsten Artikel des täglichen Grundbedarfs waren nicht mehr zu haben. Erdöl und der auf Kuba vorwiegend daraus gewonnene Strom wurden knapp, viele Lebensmittel sind rationiert, die Gesundheitsversorgung mußte ihre Leistungen einschränken. Zuggleich fällt aber auf, daß den Kubanern auch nichts vorgegaukelt wird. Castro verkündete Anfang '93 sogar, man sei aus der Talsohle noch nicht heraus, es würde wohl erst einmal noch schlechter werden.
Durchhalteparolen prägen auch den Alltag auf der Karibikinsel. Doch die sind es nicht, die die Bevölkerung bei der Stange halten. Es ist wohl die Ehrlichkeit, mit der Probleme benannt werden und die Phantasie, die aufgebracht wird, um sie zu lösen. An dieser Stelle zu behaupten, die Kubaner stünden alle geschlossen hinter Fidel und dem Sozialismus, ist natürlich Unsinn. Doch in einem ist man sich einig: Es ist ihre Sache, was auf der Insel passiert. Die Souveränität Kubas und das Recht, einen eigenen Weg zu gehen, würden die allermeisten Kubaner, die ich getroffen habe, auch mit der Waffe gegen jede Invasion verteidigen.
Im Oktober 1991 beschloß ein KP-Kongreß eine Öffnung des kubanischen Marktes für ausländische Investoren und die Zulassung von religiösen Menschen für Regierungspositionen. Eine Dezentralisierung und langfristige Alternativkonzepte in vielen Bereichen haben bereits zu einer fühlbaren Entspannung geführt. Gleichzeitig hat jedoch auch die Einführung von „Joint Ventures“ mit kapitalistischen Unternehmen die Frage aufgeworfen, wie viel Kapitalismus ist für die Erhaltung des Sozialismus moralisch tragbar? Der angestrebte Devisenfluß ist nicht die einzige Folge des boomenden Tourismus. Immer mehr setzt sich in Kuba ein „Zwei-Klassen-System“ durch. Die Trennungslinie verläuft zwischen denen, die it Touristen zu tun haben – und daher Dollar besitzen – und jenen, die keinen Kontakt zu ihnen haben und daher die begehrte US-Währung, die einem auch im sozialistischen Kuba Tür und Tor öffnet, nicht besitzen.
Ein jugendlicher Kofferträger bekommt manchmal fünf bis zehn Dollar Trinkgeld täglich, das entspricht nach dem neuen Umrechnungskurs etwa einem Monatslohn einer Lehrerin. Zwar gibt es die meisten Lebensmittel ohnehin nur noch rationiert und auf Bezugsschein, aber mit den Dollars kann man sich jedes Extra in den Intourist-Shops leisten. Auch wenn es verständlich sein mag, daß Kuba die Devisen braucht, um Medikamente, Treibstoff und Ersatzteile zu importieren – das Wenigste, um die Produktion und einen gewissen Mindeststandard aufrechtzuerhalten –, hinterläßt die offensichtliche Besserstellung des den Urlaubswonnen frönenden Klassenfeindes einen schalen Geschmack.
Auch Kriminalität und Prostitution nehmen zu. Die Jugendzeitung „Juventud Rebelde“ veröffentlichte eine eigene Untersuchung zu dem Thema und stellte fest, daß existenzielle Nöte bei keiner der in der Untersuchung erfassten 30 sich verkaufenden Frauen vorhanden waren. um seine Grundsicherung braucht bisher auch kein Kubaner zu bangen. Es geht Kuba schlecht, das ist sicher. Aber, so hört man's auf der Insel, es geht allen gleich schlecht. Da mag die westliche Presse über die „Privilegien der Parteibonzen“ schreiben, die Kubaner selbst wissen, daß es nicht so ist. Privilegiert sind in erster Linie jene, die ihre Geschäfte – legal oder illegal – im Touristikbusiness machen.
Weitere tiefgreifende Wirtschaftsreformen sollen folgen. Unter anderem soll ein Steuersystem eingeführt werden. Bisher war, da alles in staatlicher Hand lag, keines vonnöten gewesen. Auch sollen die Staatsbetriebe zukünftig nach den Grundsätzen der Rentabilität arbeiten und Subventionen für bisher kostenfreie Dienstleistungen z.T. gestrichen werden. Fidel verspricht aber dennoch, „die wesentlichen Errungenschaften des Sozialismus werden wir nicht aufs Spiel setzen.“ Natürlich beschweren sich auch alle über die Zustände. Wer würde das in einer vergleichbaren Situation nicht tun? Doch dies als Vorboten eines Untergangs, als Ablehnung in der Bevölkerung, zu deuten, ist zu einfach. Die Erinnerungen an das Batista-Regime und die US-Dominanz sind noch frisch, viele wollen eine solche Erfahrung nicht wiederholen. Und auch unter der Jugend, unter der die Ablehnung gegenüber dem System größer erscheint, wissen die meisten, daß Kuba mit einem kapitalistischen System eher wie Haiti als wie Miami aussehen würde.