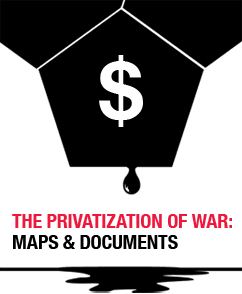Vor Ort: 70 Prozent der Bewohner von Chiapas leben unterhalb des Existenzminimums
Von den Kaziken in den Dschungel gedrängt
Die Landschaft von Chiapas ist wunderschön, verwehrt nicht gerade ein Bohrturm der staatlichen Erdölgesellschaft Pemex den Ausblick. Geprägt wird die Region vom Lacandonen-Urwald, dem größten Dschungelgebiet Mexikos, und den vielen Kaffeeplantagen an den Hängen der bergigen Landschaft.
Die Region ist reich an Naturressourcen: Die Hälfte des mexikanischen Kaffees wird dort produziert, je ein Drittel der Erdölfördermenge und der Energie aus Wasserkraft werden dort gewonnen. Dennoch oder gerade deshalb geht die soziale Schere weit auseinander. 70 Prozent der 3,2 Millionen Bewohner von Chiapas verdienen nicht einmal den Mindestlohn von 3 Dollar am Tag.
Die Kaziken, die allmächtigen Großgrundbesitzer, halten den Großteil fruchtbaren Bodens. Die indianische Bevölkerung, vorwiegend Tzeltales, Choles und Tzotziles allesamt Nachfahren der Mayas wurde in die Dschungelgebiete der einzigen Region mit indianischer Bevölkerungsmehrheit gedrängt.
Da die mexikanische Revolution vor 80 Jahren nicht nach Chiapas gekommen ist, blieben die Machtverhältnisse in der einst zu Guatemala gehörenden Region unangetastet. Landkonflikte sind seit der blutigen Unterwerfung durch die Spanier vor 500 Jahren an der Tagesordnung. Als 1969 Ackerland von Großgrundbesitzern neuverteilt wurde, kassierten diese ab und blieben auf ihren Ländereien. Die Regierung ließ den Kaziken freie Hand: Die indianische Bevölkerung wurde von bezahlten Killern in die Dschungelgebiete vertrieben.
Zwar gestand die Regierung der Bevölkerung zu, eine eigene Sprache zu haben, doch da es in vielen Gebieten gar keine Schulen gibt, konnten diese schwerlich auf die indianischen Sprachen umgestellt werden. Und in den wenigen existierenden Schulen lernen die Kinder, daß ihre Vorfahren Azteken und Spanier gewesen sein sollen. Für die Bewohner von Chiapas, die nie von den Azteken unterworfen worden waren, gleicht dies einer Verhöhnung. Auch die medizinische Versorgung ist mangelhaft. Vor den Krankenhäusern von San Cristóbal de las Casas und der anderen Städte bilden sich lange Schlangen. Schwerkranke alte Menschen, Mütter, deren Kinder infizierte Wunden, Knochenbrüche usw. haben oftmals sind sie über einen Tag unterwegs gewesen warten geduldig, um etwas zu bekommen, das ihnen oft nicht hilft. Auch auf Ämtern hat es die Bevölkerung nicht leicht, denn die besseren Jobs sind fast ausschließlich mit Mestizen besetzt, die der indianischen Sprachen nicht mächtig sind. Und dies, obwohl außerhalb der Stadtzentren und Amtsstuben Spanisch kaum zu hören ist.
Schon vor dem Aufstand fuhren schwer bewaffnete Polizeieinheiten mit ihren Jeeps als Herren durch die 80.000 Einwohner-Stadt San Cristóbal. Wer den Rambos in den Weg kommt, muß Angst haben, zusammengeschlagen zu werden. Hunderte Indianer füllen die Gefängnisse, nur wenige hatten ein Verfahren, ein faires niemand. Nur auf den Märkten werden sie geduldet, dürfen ihr buntes Kunsthandwerk den Touristen verkaufen.
Einige Landlose haben Ländereien besetzt, wo sie versuchen, gemeinsam zu wirtschaften und auch Alphabetisierung wie politische Bildung selbst organisieren. 1991 wurden zwei dieser Dörfer nahe San Cristóbal von paramilitärischen Polizeieinheiten mit Hubschraubern unter Beschuß genommen und die Bewohner in die Wälder vertrieben. Dann wurden die Dörfer vollständig zerstört.