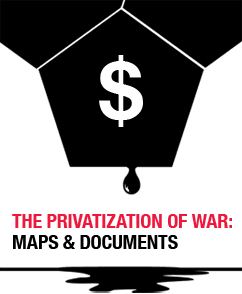Die Öffnung und der Wandel auf der Karibikinsel sind sichtbar – mehr Privatwirtschaft und mehr Debatten
Kuba bewegt sich doch
Gestern wurde Kubas Einkammerparlament neu gewählt. Der Volkskongress hat wenig reale Macht. Pro Kandidat gibt es einen Sitz und damit keine Überraschun- gen. Doch jenseits der institutionellen Strukturen ist die Karibikinsel derzeit durchaus im Wandel begriffen.
Die Meinungen zum Wandel in Kuba gehen auseinander: »Gar nichts«, antwortet der Chauffeur auf die Frage, was sich geändert hat, wortkarg. Er drückt auf dem
CD-Player der Autoanlage herum und wechselt die Musik. Offensichtlich ist er nicht zum Reden aufgelegt. Dass Kuba im Wandel begriffen ist, zeigt sich für Außenstehende indes schon am Taxi: ein schwarzer Neuwagen mit Schiebetüren
und einer Klimaanlage, die das Wageninnere trotz tropischer Außentemperatu- ren fast auf Gefrierschrankniveau herunterkühlt. Ein Blick nach draußen zeigt
weitere Veränderungen: Auf den Straßen herrscht für kubanische Verhältnisse regelrechter Autoverkehr. Neuwagen machen ein gefühltes Drittel des Fuhrparks
aus. Und auf den Straßen von Miramar, etwas außerhalb von Havanna, sind beim Vorbeifahren sofort zahlreiche kleine Restaurants und Läden zu sehen, die
letztes Jahr noch nicht da waren.
Der Grund für die Kuba-Reise ist das »X. Internationale Arbeitstreffen Emanzipatorischer Paradgimen «. Eine Konferenz, die von linken regierungsun-abhängigen Basiskräften organisiert wird und alle zwei Jahre stattfindet. Im
zentralen Versammlungssaal des Gewerkschaftshauses, das für die Konferenz zur Verfügung gestellt wurde, hängen an den Wänden Transparente und Fahnen. Auf einem lila Banner verkündet eine Basisorganisation aus Nicaragua
ihre Solidarität mit Kuba, auf einem handgeschriebenen Plakat steht »Revolutionär sein heißt Häretiker sein«. »Solidarität mit den chilenischen Studierenden« verkündet ein anderes Plakat, wieder ein anderes drückt Solidarität mit dem erkrankten venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez aus. Diverse Plakate und Transparente verkünden feministische Positionen, andere wiederum Solidarität mit den Zapatistas aus dem mexikanischen Chiapas. Ausdruck der Vielfalt Lateinamerikas.
Am Ausgang des Saals und draußen stehen Tische, auf denen linke Bücher und Zeitschriften, DVDs, Postkarten, Aufkleber und mit Parolen bedruckte T-Shirts feilgeboten werden. Es sieht aus wie auf jedem linken Basiskongress
in Lateinamerika. Für die kubanischen Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist das aber keineswegs gewöhnlich.
Die Atmosphäre ist ausgelassen, überall bilden sich kleine Gruppen und diskutieren angeregt miteinander. Etwa 400 linke Aktivisten und Intellektuelle aus Lateinamerika, den USA und dem Baskenland sind in diesem Jahr
gekommen. Die Konferenz wird wesentlich von der Forschungsgruppe GALFISA (Sozialphilosophie und Wertelehre in Lateinamerika) des Philosophie-instituts der Universität von Havanna und vom »Centro Martin Luther King« organisiert. Unterstützung erhalten sie von diversen linken akademischen Organisationen und Bewegungsnetzwerken aus Lateinamerika sowie dem Baskenland. Allein dass eine Konferenz auf Kuba nicht von offiziellen Regierungsinstitutionen
organisiert ist, ist schon eine Besonderheit. Doch auch das Format, die Inhalte und die Gäste der Konferenz zeugen von den in Kuba stattfindenden Veränderungen.
Am ersten Abend wird die Konferenz mit Berichten verschiedener Frauen aus den Basisräten des Zentrums Havannas eröffnet. Doch statt von allen erwarteten
langatmigen Lobeshymnen auf Regierung, Staat und Sozialismus, sprechen die Frauen eine nach der anderen von den Schwierigkeiten im Alltag. Eine Frau berichtet davon, keine anständige Wohnung zu haben und auf der Suche nach
Verbesserung seit Jahren von allen Behörden abgewiesen zu werden.
Die schonungslosen Berichte der kubanischen Frauen, die zugleich keinen Zweifel daran lassen, dass sie die kubanische Revolution unterstützen, sind so ungewohnt, dass die Internationalistin, die am nächsten Konferenztag den Abend noch einmal zusammenfasst, glatt vergisst, die kritischen Töne zu erwähnen.
In meiner Diskussionsrunde geht es um Volksmacht und Partizipation. Aktivisten aus dem Umfeld der Zapatistas in Mexiko, von den Naza-Indianern in Kolumbien und aus Basisräten aus Venezuela nennen ihrer Ansicht nach notwendige Elemente für einen partizipativen Sozialismus: lokale Selbst-verwaltung, Arbeiterkontrolle, demokratische Partizipation an Entscheidungen, die Erarbeitung von eigenen Lösungen auf der Grundlage der eigenen Kultur und
vieles mehr. Die Diskussion kommt in Gang. Pablo, Mitte 60, eine ansehnliche
Karriere im kubanischen Verwaltungsapparat hinter sich, greift die Frage der Arbeiterkontrolle auf und betont, wie wichtig es sei, gerade jetzt auf Kuba dies zu diskutieren und umzusetzen. »Unser großes Problem ist die Bürokratisierung
auf Kuba, wir brauchen mehr Selbstverwaltung.« Es hapert offenbar in der Praxis: »Eigentlich haben wir ja verschiedene Ebenen, auf denen eine direkte Einfluss- nahme der Bevölkerung auf ihre Belange stattfinden soll, aber es funktioniert kaum und anstatt zu garantieren, die Meinung der Bevölkerung in die Regierungsinstanzen zu tragen, geschieht, wenn überhaupt etwas geschieht, eher das Gegenteil«, so Esther, eine Akademikerin Mitte 50 aus Havanna. Pablo fügt hinzu: »Staat und Revolution sind eigentlich ein Widerspruch, auch wenn wir in absehbarer Zeit nicht auf den Staat verzichten können angesichts der internationalen Verhältnisse. Daher stellt sich die zentrale Frage, wie wir mit diesem Widerspruch umgehen, damit er nicht die Revolution zunichtemacht.
« Aus marxistischer Sicht eine banale Feststellung, doch für Kuba und jeden anderen parteiorientierten Staatssozialismus eine bis vor kurzem noch unaussprechliche Erkenntnis. Der kubanische Staatsapparat ist indes weit
davon entfernt, so unbeweglich zu sein wie von außen häufig dargestellt.
In der Landwirtschaft sind Genossenschaften bereits seit einigen Jahren eingeführt worden. Auch wenn die Partizipation der Beschäftigten noch zu wünschen übrig lässt und die Eingriffe des Staates in die Genossenschaften von ihrer begrenzten Selbstverwaltung zeugen, ist dies ein bedeutender Schritt. Lange Zeit galten Genossenschaften auf Kuba als kleinbürgerlich. Nach der jüngsten Öffnung Kubas für die Privatwirtschaft veröffentlichte die kubanische Soziologin Camila Piñeiro Harnecker 2011 einen Sammelband zu Genossen-schaften im Verlag des unabhängigen »Centro Martín Luther King«. Harnecker, Tochter des Revolutionsführers Manuel Piñeiro »Rotbart« und der chilenischen Soziologin Martha Harnecker – wollte mit anderen in diesen wichtigen Zeiten des Umbruchs neben dem individuellen Unternehmertum auch Erfahrungen kollektiver Unternehmenspraktiken als Option anbieten. Die erste Auflage von 2000 Exemplaren war innerhalb von nicht einmal drei Monaten ausverkauft. Der Staat wurde aufmerksam und nahm das Buch in das offizielle Programm eines staatlichen Verlages auf. Seit einem Jahr diskutiert die kubanische Regierung nun auch die Umwandlung von verschiedenen Dienst-leistungsstrukturen, vor allem von Restaurants und Cafés, und ihre Übergabe an die Beschäftigten.
In jeder Pause bilden sich auf dem Kongress Trauben um die Büchertische, die linke Literatur feilbieten, die sonst auf Kuba nicht zu finden ist. Ana, Agrar-ingenieurin aus Kuba, entdeckt auf einem Büchertisch die spanische Ausgabe von Marina Sitrins Buch zu »Horizontalität: Stimmen der Volksmacht in Argentinien«. In dem Buch berichten Stadtteilversammlungen und besetzte Betriebe über ihre basisdemokratischen Organisationsformen und den Aufbau von Alternativen. Ana ist ganz begeistert: »Das kann ich gut einsetzen bei meiner Arbeit auf dem Land!« Sie arbeitet mit ländlichen Gemeinschaften und mit einigen der neu eingerichteten landwirtschaftlichen Genossenschaften.
Die anwesende Autorin Marina Sitrin, selbst Aktivistin von Occupy Wall Street, schenkt Ana ihr Buch. So handhaben es die meisten anwesenden internationalen
Gäste mit den Kubanern und Kubanerinnen, deren Peso-Löhne umgerechnet selten mehr als 25 bis 30 US-Dollar betragen. Mit ihren regulären Monatslöhnen
können staatliche Angestellte auf Kuba zwar das Notwendige zum Leben kaufen und sind angesichts der Leistungen in den Sektoren Bildung, Kultur, Sport
und Gesundheit auch nicht aus dem sozialen Alltag ausgeschlossen, »Extras« lassen sich damit jedoch nicht bezahlen. Doch die Extras werden immer häufiger.
Staatliche Geschäfte und sogar kleinere »Einkaufszentren« bieten zunehmend importierte Waren und Lebensmittel gegen konvertierbare Kubanische Peso (CUC) an. Ein CUC entspricht einem USDollar und ist derzeit etwas mehr Wert als 24 reguläre kubanische Pesos. Hunderttausende Kubaner und Kubanerinnen haben als Selbstständige, sogenannte cuentapropistas, ihr eigenes Geschäft
begonnen. Säfte und Sandwiches werden aus dem Wohnzimmer heraus oder durch die Gitter der Eingangstüren verkauft. Obst- und Gemüsehändler bieten ihre Waren auf Märkten und in Eckläden an, überall entstehen neue »Paladares
«, wie die Privatrestaurants genannt werden.
Beim Spaziergang durch Havanna fallen kleine Geschäfte ins Auge, aber auch Lebensmittelhändler mit Karren und Straßenstände mit Büchern, Wasserhähnen,
Technikausrüstung und sogar kopierten Filmen, TV-Serien und Musik-CDs. Besonders viele Händler verkaufen importierte Kleidung und Modeaccessoires.
»Es hat sich viel geändert, aber für mich ist alles gleich geblieben«, stellt Daniela nüchtert fest. Sie arbeitet als Ärztin in einer Klinik, ist 45 Jahre alt und lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Mutter. »Meine Arbeit ist die gleiche, mein
Schichtplan ist gleich geblieben und mein Gehalt ist unverändert.
Ich sehe, das ständig neue Geschäfte und Restaurants eröffnen, ich kann mir aber nichts davon leisten.« Daniela ist bedingt durch ihre Arbeit immer wieder mal im Ausland, sie reist zu Kongressen und Konferenzen, kürzlich war sie in Frankfurt am Main. So wie vielen anderen Kubanern auch käme es ihr niemals in den Sinn, nicht nach Kuba zurückzukehren. »Grundsätzlich halte ich Sozialismus für die richtige Gesellschaftsform. Und auch wenn ich finde, dass einiges in Kuba anders laufen müsste, um weiter in Richtung Sozialismus zu gehen, ich will nicht
woanders leben. Und ich will auch keinen anderen Beruf ausüben, ich finde es wichtig und richtig, Ärztin zu sein«. Doch so wie viele andere hoch qualifizierte staatliche Angestellte fragt sich auch Daniela insgeheim, was sie denn falsch gemacht hat, wenn Privilegien nun käuflich sind und Engagement für die Gesellschaft den Zugang eher behindert.
Die sozialen Unterschiede wachsen rasant zwischen Stadt und Land, zwischen Selbstständigen und Angestellten, zwischen Berufen mit Kontakt zu Touristen
und solchen ohne. So ziehen es manche hoch ausgebildete Akademiker nun doch lieber vor, ein eigenes Geschäft aufzubauen, anstatt in ihrem Beruf zu arbeiten. »Ich weiß nicht, ob diese ganze Öffnung für die Privatwirtschaft gut ist«, gibt Malev zu bedenken. Malev, Brite mit asiatischen Eltern, ist erst seit wenigen Wochen in Havanna. Er ist seiner kubanischen Freundin Niuska gefolgt, die
er während ihres Studiums in Barcelona kennengelernt hatte.
»Einerseits besteht nun auch hier Zugang zu vielen Gütern, die für uns schon lange zum Alltag gehören, andererseits spaltet dies die Gesellschaft. Kurzfristig blieb Kuba vielleicht nichts anderes übrig, aber langfristig …« Die Bedenken
sind Malev ins Gesicht geschrieben.
Am Tag meines Abflugs aus Kuba tritt die neue Reiseregelung in Kraft. Nun können alle Kubaner und Kubanerinnen einen Pass erhalten und reisen, wenn sie die Konditionen der Länder erfüllen, die sie besuchen wollen. Eine Woche
später geht der von Venezuela initiierte lateinamerikanische Gemeinschafts-sender TeleSUR in Kuba über Antenne auf Sendung – als erster offiziell zu empfangender Auslandssender. Das Kuba sich gerade rasant verändert, steht außer Frage.
Artikel auch als .pdf Datei zum Download