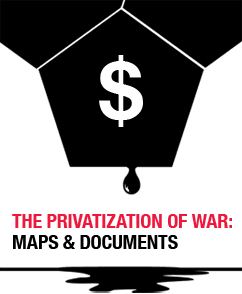VENEZUELA UND DAS PROGRAMM "BARRIO ADENTRO"
Castros weiße Kolonne
Die Opposition schäumt, seit die Regierung von Hugo Chávez auf die Hilfe kubanischer Ärzte zurückgreift
Unter heißer Mittagssonne arbeiten acht junge Frauen auf einem winzigen Feldrain mit bestenfalls 50 Quadratmetern Fläche. Sie lockern mit Spaten schwarze, tintige Erde, ziehen Furchen und streuen vorsichtig Saatgut aus kleinen Gläsern hinein. Ambar Centeño, Agraringenieurin des Nationalen Instituts für Erzieherische Kooperation (INCE), erklärt, wie tief die Aussaat erfolgen muss. In wenigen Wochen sollen hier Tomaten, Zwiebeln, Salat, Paprika und Gurken wachsen.
Das alles geschieht weit oben über der Stadt in Las Casitas/Quinta Terraza ("Die Häuschen/Fünfte Terrasse)", wo um die Mittagszeit vom Himmel kaum eine Spur, nur gleißendes, brennendes Licht bleibt.
Gurkenbeete am "Hilton"
Je mehr Caracas an Höhe gewinnt, um so unübersehbarer wird sein Abstieg - desto ärmer werden die Viertel und ihre Bewohner. Entlang der Straße hinauf nach Las Casitas stapelt sich Müll, die verstreut in die Gegend geratenen Container quellen über, einige der Steilhänge sind zu Müllkippen degradiert. Während an Unrat und Dreck keinerlei Mangel herrscht, ist für Wasser das Gegenteil der Fall. Wie an den schrundigen Rändern der Hauptstadt üblich, kann auch Las Casitas nur jeden vierten Tag versorgt werden. Aus Reservoiren der Unterstadt wird das Wasser hoch gepumpt, in großen Zisternen gelagert und von dort in jene Plastiktonnen gefüllt, die hier zu jedem Haushalt gehören wie die Luft zum Atmen. Während der Dürre in den vergangenen drei Jahren hat Caracas über seine Verhältnisse gelebt, so dass auch in den besseren Quartieren oft nur ein schmales Rinnsal aus den Hähnen läuft.
Wasser für Caracas muss aus einem 600 Kilometer entfernten Stausee über ein Aquädukt mit 300 Pumpstationen geleitet werden - eine Havarie irgendwo auf dieser Trasse käme einer Katastrophe gleich. Für den urbanen Gemüseanbau in Las Casitas sind das keine idealen Umstände. Wenigstens hat das Programm Alle Hände zur Aussaat! mit der Welternährungsorganisation FAO einen seriösen und zahlungskräftigen Schirmherrn gefunden, um bei der Versorgung des Landes wieder mehr auf eigene Ressourcen setzen zu können. Immerhin müssen inzwischen mehr als 60 Prozent der Lebensmittel eingeführt werden. Im Vertrauen auf nie versiegende Öleinnahmen hatte sich das einstige Agrarland seit Mitte der siebziger Jahre zusehens als Lebensmittelimporteur eingerichtet.
Heute nehmen sogar in der Innenstadt die Freiflächen stetig zu, auf denen statt einladender Parklandschaften profane Gemüsekulturen gepflegt werden. Direkt hinter dem Hilton-Hotel beispielsweise erntet eine Kooperative Gurken und Tomaten, die durch das erwähnte Nationale Institut INCE verkauft werden.
Für die Felder von Las Casitas kommen kommerzielle Interessen nicht in Betracht, die Ernte reicht allein für die Eigenversorgung. Der angrenzende Naturpark soll nichtangerührt werden, um mehr Anbaufläche zu haben. "Diese Art von Selbsthilfe gab es hier schon, als Hugo Chávez noch ein braver Soldat war und vielleicht davon träumte, Präsident zu werden", meint Edgar Pérez von der Initiative Ateneo Caribes de Itagua, "wir unterstützen ihn jetzt, weil seine Regierung uns unterstützt." Pérez bezeichnet sich als "aufgeklärten Demokraten", was bedeute, "selbstbestimmt zu leben" und den Willen der Mehrheit im Viertel zu respektieren, aber das sei ja nun "Staatspolitik".
Subversion in "Carretera Vieja"
Letzteres gilt auch für das Programm Barrio adentro ("Im Innern des Viertels"), mit dem 500 kubanische Ärzte in die Refugien der Armen geschickt werden, um die Menschen dort, für zwei Jahre mindestens, medizinisch zu versorgen. Das Erscheinen der Kubaner ist ein Schlag ins Kontor des venezolanischen Bürgersalons. Die Opposition kann sich über Barrio adentro nicht genug entrüsten und hetzt gegen "Castros Missionare": Man verfüge über genügend eigene Mediziner, exzellente Spezialisten - wozu fremde Hilfe in Anspruch nehmen? Die Patienten hingegen sind zufrieden, venezolanische Mediziner haben sich bisher mehrheitlich geweigert, in den schlechter betuchten Vierteln Praxen zu eröffnen, geschweige denn in diesem Milieu zu leben. Es gab drei Aufrufe der Regierung an den Nationalen Ärzteverband, sich dem Projekt Barrio adentro anzuschließen, nur 80 Ärzte landesweit reagierten. Wenn die Kubaner Ende 2004 in ihr Land zurückkehren, werde das Programm - so hofft die Regierung - soweit überzeugt haben, dass es wenigstens dann von Venezolanern übernommen wird.
Damit dank Barrio adentro ein Kubaner seine Arbeit aufnehmen kann, müssen durch das jeweilige Stadtviertel Behandlungszimmer, Warteraum und Unterkunft selbst zur Verfügung gestellt werden. Der Staat bezahlte die fällige Renovierung - das Barrio führt sie aus. In Carretera Vieja etwa, dem Nachbarquartier von Las Casitas, hat eine Familie den vorderen Teil des eigenen Hauses für die Praxis hergegeben und der kubanischen Ärztin zusätzlich ein Zimmer eingerichtet.
"Ich war schon mehrmals bei der Kubanerin, allein und mit den Kindern", erzählt Odali Sánchez. "Diese Ärztin ist ein Segen. Früher war es in dieser Gegend völlig ausgeschlossen, nachts von irgendwoher Hilfe zu bekommen. Meinem Mann hat sie das Leben gerettet, als er mit einer schweren Viruserkrankung von einem Hospital in der Stadt abgewiesen wurde, weil die Ärzte dort mit dem Oppositionsstreik sympathisierten. Im Fernsehen wird jeden Tag versucht, uns davon zu überzeugen, die kubanischen Ärzte zu meiden, sie seien schlecht ausgebildet und außerdem Kommunisten. Sollten wir uns danach richten, hieße das, keinen Arzt zu haben. Meine Schwiegermutter glaubte den Medien unbesehen, doch seit sie krank war und ihr nichts anderes übrig blieb, als hierher zu kommen, hat sich ihre Meinung geändert."
Maria Elena Alfonso, die Ärztin für Carretera Vieja, ging freiwillig nach Venezuela. "In den Barrios werden wir wie selbstverständlich aufgenommen, niemand idealisiert unsere Arbeit, niemand dramatisiert sie. Wir fühlen uns hier nicht anders als in Havanna oder Cienfuegos. Ich habe mich aus humanitären Gründen für dieses Land entschieden. Als Internistin will ich Menschen helfen, die sonst nie in den Genuss einer Behandlung kämen." Am häufigsten habe sie es mit Magen- und Darmerkrankungen zu tun, die größtenteils der Armut geschuldet seien.
Die Behauptung der Oppositionsparteien, es handele sich mit ihrem Einsatz um "gezielte kommunistische Infiltration", ist für Maria Elena absurd. "Wir waren mit akkurat dem gleichen Programm zur Gesundheitsfürsorge auch in Guatemala, dessen Regierung wirklich über jeden Verdacht erhaben ist, irgendwelche Sympathien für Kuba und den Sozialismus zu hegen."