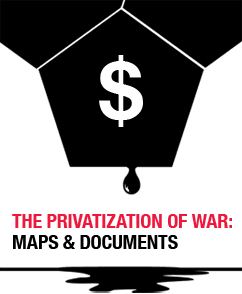Die Schwierigkeiten der Arbeiterkontrolle
Selbstverwaltete Betriebe als Chance?

Selbstverwaltete Betriebe als Chance? Die Schwierigkeiten der Arbeiterkontrolle
von Dario Azzellini*, in: express 8/2025
Dario Azzellini, Marcelo Vieta:
»Commoning Labour and Democracy at Work. When Workers Take Over«,
Routledge 2025, ISBN: 9780367442224, 328 Seiten, 175 Euro
(eine günstige Taschenbuchausgabe erscheint in Kürze).
Um die Jahrtausendwende kam es in Argentinien zu über 200 Betriebsbesetzungen durch Arbeiter:innen, die ihre Betriebe in Selbstverwaltung übernommen haben. Heute sind es über 430 Betriebe allein in Argentinien. Selbstverwaltete Betriebe finden sich vor allem in Lateinamerika, nicht wenige auch in Europa. Das Buch Commoning Labour and Democracy at Work bietet eine umfassende Analyse internationaler Erfahrungen der Kämpfe, die es um diese Betriebe unter Arbeiterkontrolle gibt. Dario Azzellini und Marcelo Vieta fokussieren sich auf wiedereroberte Betriebe unter Arbeiterkontrolle, bei denen Beschäftigte bankrotte oder geschlossene Unternehmen übernehmen und in Genossenschaften oder anderen demokratischen Strukturen (zum Beispiel als Unternehmen mit demokratischer Betriebsverfassung oder als Betriebe unter demokratischer lokaler Selbstverwaltung) weiterführen.
Die Autoren verstehen kollektive Selbstverwaltung als klassenbasierte Antwort auf die multiplen, strukturellen, zyklisch wiederkehrenden Krisen des Kapitalismus. Die Aneignung der Produktionsmittel durch »Rückeroberte Betriebe unter Arbeiterkontrolle« (RBA) eröffnet alternative Formen produktiven Lebens. Die Gemeinschaft der frei Assoziierten verwandelt Arbeit in Gemeingut, sogenannte Commons. Azzellini und Vieta argumentieren, dass RBA neue Formen solidarischer und nachhaltiger Arbeit ermöglichen und demokratischere Gemeinschaftsökonomien fördern.
Im ersten Teil des Buches werden die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen dargelegt. Azzellini und Vieta argumentieren für eine Aktualisierung des Klassenbegriffs, begründen ihren Fokus auf Arbeit, skizzieren eine Klassenkampfperspektive auf Selbstverwaltung und beleuchten zentrale Widersprüche der Selbstverwaltung. Daran anknüpfend diskutieren sie Varianten der Betriebsübernahme durch Arbeiter:innen und die Spezifika der RBA. Es folgt eine kritische Einordnung zentraler Debatten über Selbstverwaltung. Diskutiert werden die Widersprüche, in denen sich Genossenschaften befinden, die Probleme, vor denen Räte und Arbeiterkontrolle in peripheren Staaten stehen, und dass sich RBA in Krisenzeiten behaupten müssen.
Der zweite Teil widmet sich konkreten RBA-Erfahrungen in Lateinamerika, dem Kontinent mit den meisten Betrieben unter Arbeiterkontrolle. Hier werden zunächst mehrere RBA in Argentinien vorgestellt, darunter auch international kaum bekannte Fälle wie der einer Klinik unter Kontrolle der Belegschaft. Es folgen ein Kapitel zu RBA in Brasilien und Uruguay sowie ein weiteres zu verschiedenen Formen von Partizipation und Arbeiterkontrolle in der Produktion in Venezuela.
Im dritten Teil werden RBA in Europa und weltweit beleuchtet. Ein erstes Kapitel handelt von RBA in Frankreich und Italien, beides Länder mit einem relativ großen Genossenschaftssektor, in denen diverse RBA entstanden sind. Eine Reihe von Fallbeispielen, darunter RiMaflow, GKN und ScopTi (Ex-Fralib), wird genauer untersucht. Hinzu kommen im nächsten Kapitel Fallbeispiele von RBA in Griechenland, Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, der Türkei, Spanien, Russland, dem Vereinigten Königreich, Irland und weiteren Ländern. Ein drittes Kapitel gibt einen Überblick über Betriebsbesetzungen und - übernahmen in Ägypten und Nordafrika, Kanada und den USA. Der Fokus liegt jeweils auf Kontexten, Herausforderungen und lokalen Besonderheiten.
Der vierte und letzte Teil führt die Diskussion zusammen. Die Autoren analysieren, wie Arbeit durch RBA zu Commons, das heißt zu einer kooperativen Arbeits- und Lebensweise werden kann, und wo Widersprüche und Chancen liegen. Zunächst wird die Rolle von Commons im Kapitalismus analysiert, ihre Aktualität und ihre Fähigkeit zur gesellschaftlichen Transformation, die die Autoren anhand der Herausbildung von »Labour Commons« beschreiben, also der Dekommodifizierung der Ware Arbeitskraft und ihrer Transformation in ein Gemeingut. Im zweiten Kapitel folgen Gemeinsamkeiten der verschiedenen Formen von RBA: die Krisenursachen, die politische Sphäre des Kampfes, die kooperativen und horizontalen Organisationsstrukturen, die Praxis der demokratischen Selbstverwaltung, beruhend auf Gleichheit und einer Arbeit ohne Entfremdung, sowie die Erfahrung kollektiver Arbeit mittels Commoning. Im folgenden Kapitel geht es um die duale Realität der RBA, die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen angesichts der spezifischen Produktion und des Zustands der Produktionsmittel, die verschiedenen nationalen bzw. regionalen politischen Kulturen und das ambivalente Verhältnis zum Staat, das Verhältnis zu Gewerkschaften, das Problem der weiterhin bestehenden Marktlogiken sowie die Aussichten auf sozioökonomische Alternativen. Den Abschluss dieses Teils macht ein Kapitel, in dem die Erfahrungen und Erkenntnisse zusammengefasst werden und der Blick auf den emanzipativen Charakter der kollektiven Arbeitserfahrungen gerichtet wird.
Beim Autor nachgehakt
Renate Hürtgen: Ihr habt sieben Jahre lang an diesem Buch gearbeitet, das auf eine inzwischen dreimal so lange Forschung zum Thema zurückgeht. Was war Euch besonders wichtig?
Dario Azzellini: Eigentlich hatten wir noch vor, verschiedene Beispiele für eine rätedemokratische Selbstverwaltung aufzunehmen wie die indigenen Gemeinden der Zapatistas in Chiapas/Mexiko, die auf eigener Polizei und Justizsystem fußende indigene Selbstverwaltung in Guerrero/Mexiko, den Aufstand und die Gründung der »Commune von Oaxaca«, ebenfalls in Mexiko, Rojava im syrischen Teil Kurdistans, die Nachbarschaftsräte in der indigenen Großstadt El Alto in Bolivien oder eben die Selbstregierung durch Kommunale Räte und Comunas in Venezuela. Uns interessiert, wie die konkreten Abläufe im Rahmen einer rätedemokratischen Organisation und unter kommunaler Kontrolle der Produktion aussehen. Das wird Thema eines zweiten Buches sein.
R. H.: Ihr versammelt im Buch Beispiele selbstverwalteter Betriebe aus mehr als fünfzehn Ländern Lateinamerikas und Europas. Deutschland ist nicht darunter. Wie kommt das?
D. A.: Weil es da eigentlich nichts zu sagen gibt. In den vergangenen vierzig Jahren gab es gerade mal eine Betriebsbesetzung, bei der die Beschäftigten schnell beschlossen, nur noch eine Serie zu produzieren, um dann den Betrieb freiwillig aufzugeben. (Es handelt sich um das Fahrradwerk Bike Systems, ehemals IFA-Kombinat der DDR, das 2007 besetzt wurde, R. H.) Das Thema interessiert in Deutschland nicht, nicht einmal in den Gewerkschaften.
R. H.: Wenn es diese Bewegung nicht gibt, ist das nicht auch verwunderlich?
D. A.: Es gibt vereinzelte Kräfte in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und in der Partei Die Linke, die versuchen, das Thema in die linke Diskussion zu bringen, um wenigstens eine öffentliche Position zu formulieren. Noch besser wäre, eine Struktur aufzubauen, die solche Besetzungen unterstützen kann. Es tut sich aber nichts. Ich habe 2022/23 mit einigen wenigen aus der Linken in Görlitz zwei Jahre lang versucht, in einem von Schließung bedrohten Waggonwerk in Niesky etwas anzuschieben. Das hat niemanden, auch nicht bei der IG Metall, besonders interessiert. Jetzt ist das Waggonwerk geschlossen. Das ist eine Bankrotterklärung für die Verkehrswende.
R. H.: Dennoch gibt es eine Diskussion über Alternativen zur kapitalistischen Produktion, einer angesichts der Klimaerwärmung notwendigen neuen Vergesellschaftung unseres Lebens. Stichwort: »Ökosozialistische Perspektive«. Wie würdest Du die durch Arbeiter:innen
verwalteten Betriebe in diese Diskussion einordnen?
D. A.: Die direkte Kontrolle der Produktionsmittel durch die Werktätigen, im Idealfall durch die Community, ist notwendig, aber nicht ausreichend. Zwar erhöht sich der Spielraum, im Interesse der Beschäftigten zu agieren, wenn keine fünfzehn Prozent Dividende und keine Chefgehälter gezahlt werden müssen. Aber letztlich produzieren sie in einem kapitalistischen Marktumfeld, das die Grenzen setzt. Denn wer nicht den Mehrwert in den Mittelpunkt seiner Produktion stellt, wird automatisch weniger schnell wachsen. Das hat sich in Venezuela gezeigt, wo nach fünfzehn Jahren Verstaatlichungen, Enteignungen und Genossenschaftsgründungen der Privatsektor größer war als vorher. Darum gehört der direkte Angriff auf das Kapital in allen Varianten dazu. Anders gesagt: Hier stimmt die alte Kritik von Rosa Luxemburg, dass sich Genossenschaften nicht wie Öl auf dem Wasser ausdehnen und dass sie nicht irgendwann die Mehrheit der Ökonomie stellen können.
* Dario Azzellini ist Politikwissenschaftler und Soziologe. Er forscht zu Arbeit, Selbstverwaltung, Gewerkschaften und Just Transition sowie zu Globaler Politischer Ökonomie. Mehr auf www.azzellini.net
express im Netz und Bezug unter: www.express-afp.info
Related Links: